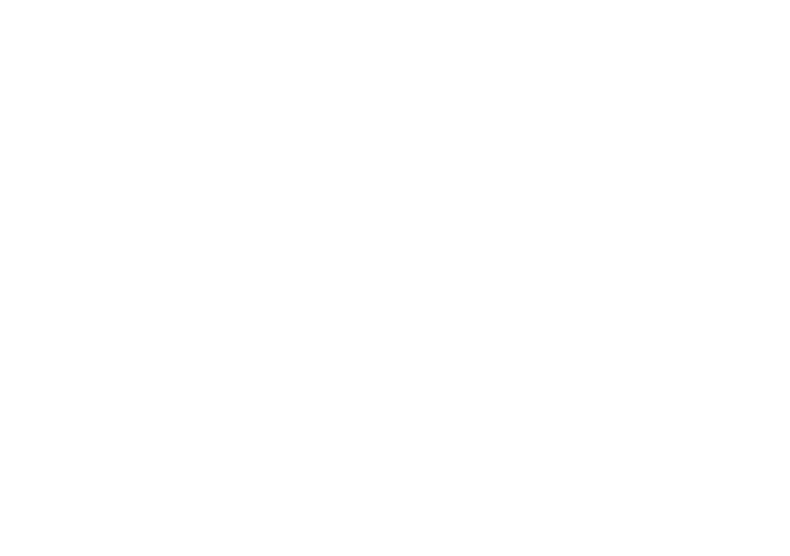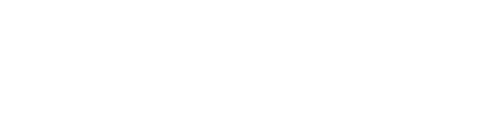Interview: Kreislaufwirtschaft in der Mode – Tina Tomovic über Haken, Hebel und Hoffnung
In einer Zeit, in der Kleiderschränke überquellen und die Umwelt unter dem „Produzieren-Nutzen-Wegwerfen“-Modell leidet, rückt ein Konzept immer stärker in den Fokus: die Kreislaufwirtschaft. Doch was bedeutet das konkret für die Textilbranche und uns als Konsument:innen? Wir haben mit Tina Tomovic, Dozentin an der Hochschule Luzern und einer führenden Expertin für Textil-Nachhaltigkeit, darüber gesprochen, wie wir gemeinsam einen nachhaltigen Weg einschlagen können.

Tina Tomovic
Frage: Um direkt ins Thema zu starten: Könnten Sie uns in einfachen Worten erklären, was genau die „Kreislaufwirtschaft“ bedeutet?
Tina Tomovic: Das Modell der Kreislaufwirtschaft verfolgt die Idee, dass wir materielle Ressourcen so lange wie möglich und so oft wie möglich verwenden – mit dem Ziel, am Ende weniger Ressourcen zu verbrauchen. Oft wird dieses Modell mit Recycling gleichgesetzt. Das ist aber falsch, denn es geht um einen ganzheitlichen Ansatz, der auch Aspekte wie Material Health (die Unbedenklichkeit und Sicherheit der verwendeten Materialien für Mensch und Umwelt im Laufe des Kreislaufs) integriert oder auch das bewusste Weglassen neuer Produkte, sprich weniger zu produzieren und weniger zu kaufen, im Sinne einer Suffizienz. Auch weitere bekannte Strategien, wie das Wiedernutzen von Produkten oder deren Reparatur, sind wichtig im Sinne der Kreislaufwirtschaft.
Frage: Warum ist das traditionelle „Produzieren-Nutzen-Wegwerfen“-Modell gerade im Textilbereich ein so grosses Problem? Was sind da die grössten Haken?
Tina Tomovic: Der Grund ist klar: Durch Fast Fashion hat der Wert von Kleidung stark abgenommen. Während die Quantität steigt, sinkt die Qualität. Damit verkürzt sich die Lebensdauer der Kleider – und auch der Handel mit, der zu sehr wachsenden Secondhand-Ware wird immer mehr zur Belastung. Das aktuelle System ist ökologisch und ökonomisch nicht mehr tragbar. Sowohl die Produktion neuer Textilien, die Gewinnung der benötigten Rohstoffe, als auch die Entsorgung, gehen heute letztendlich auf Kosten des globalen Südens. Denn die Preise, die wir für unsere Textilprodukte meist bezahlen, bilden nicht die sogenannten True Cost ab. Der True Cost ist der Preis, den Gesellschaft und Umwelt meist im globalen Süden zahlen, wenn ökologische und soziale Kosten nicht im Verkaufspreis eines Produkts enthalten sind. Sprich Kosten, die durch Umweltverschmutzung, Klimawandel, unfaire Löhne, Kinderarbeit, … verursacht werden. Für Fast Fashion bedeuten das meist, dass die wahren Kosten von Menschen und Umwelt im globalen Süden getragen werden.
Frage: Viele von uns möchten bewusster konsumieren. Was sind ein paar wenige ganz konkrete Schritte, die jede:r Konsument:in heute tun kann, um einen Beitrag zur textilen Kreislaufwirtschaft zu leisten?
Tina Tomovic: Den grössten Hebel haben Konsument:innen, indem wir bewusst auf den Kauf neuer Produkte verzichten. Auch hat es sehr positiven Auswirkungen, wenn wir weniger und vor allem weniger heiss waschen und die Textilien nicht im Trockner trocknen. Wir sollten dafür sorgen, dass unsere Kleidung generell gut behandelt wird – durch sorgfältige Pflege und Reparatur – so stellen wir sicher, dass die Kleidung lange genutzt wird und im Kreislauf bleibt.
Frage: Was sollten wir am besten mit der Kleidung tun, die in unseren Schränken verstaubt?
Tina Tomovic: Wenn Kleidung verstaubt bzw. sich ungenutzte Textilien türmen, ist in Bezug auf Nachhaltigkeit eigentlich schon sehr viel falsch gelaufen. Dann habe man mehr gekauft, als man eigentlich benötige. Konsument:innen können nur noch dafür sorgen, dass die Kleidung möglichst lange im Gebrauch bleibt. Am besten wäre es, die Stücke beispielsweise direkt an Freunde und Familie zu geben, wenn diese sie wirklich nutzen. Auch ist es wichtig, sich in Zukunft bewusst dafür zu entscheiden, dass man nur das kauft, was man wirklich benötigt – weniger ist hier definitiv mehr. Denn unerwünschten und überflüssigen Kleidern droht letztlich allen das gleiche Schicksal: der Brennofen.
Frage: Reparieren, Secondhand kaufen, Kleidung teilen oder mieten: Wie wichtig sind diese Ansätze im Kreislaufgedanken, und was können wir als Konsument:innen dabei gewinnen?
Tina Tomovic: Diese Ansätze sind absolut zentral im Kreislaufgedanken – sie repräsentieren die sogenannten Re-Strategien wie «Reduce, Reuse, Repair, Rent». Durch das Reparieren verlängern wir die Lebensdauer eines Produkts direkt und verhindern so, dass etwas Neues produziert werden muss. Secondhand-Käufe geben bestehender Kleidung ein zweites Leben, wodurch keine neuen Ressourcen verbraucht werden. Kleidung zu teilen oder zu mieten, erhöht die Nutzungsintensität eines Kleidungsstücks erheblich; es wird von mehr Menschen getragen, was die Investition an Ressourcen pro Nutzung minimiert.
Frage: Aus Ihrer Sicht als Dozentin: Was sind die spannendsten Innovationen oder Entwicklungen, die Sie aktuell im Bereich der textilen Kreislaufwirtschaft beobachten? Gibt es etwas, das Ihnen besonders Hoffnung macht?
Tina Tomovic: Das Gute ist, es gibt vielversprechende Bewegung in der Schweiz, wie beispielsweise das Programm für Textilunternehmen Sustainable Textiles Switzerland 2030. Hier verpflichten sich Unternehmen, an festgelegten Nachhaltigkeitsziele zu arbeiten, um diese in Zukunft zu erreichen, u.a. auch Ziele rund um das Thema Kreislaufwirtschaft. Auch ist das Engagement von Tell-Tex in den Bau einer innovativen Faser-zu-Faser-Recycling Anlage ein spannender Schritt. Aber auch kleine Vorstösse wie von Ademain zeigen, dass tatsächliche Bemühungen stattfinden. Ademain experimentiert als sehr kleines Unternehmen damit, wie ausgetragene Textilien von den Nutzer:innen wieder zurückgebracht werden.
Was mir besonders Hoffnung macht, ist die hohe Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Zum Beispiel beginnen Studierende bei uns bereits gut informiert das Studium und bringen eine echte, intrinsische Motivation mit, an diesen Themen weiterzuarbeiten. Auch die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) und die damit verbundene Finanzierung des End-of-Life-Managements (EOL) ist ein wichtiger Schritt, der zurzeit in der Schweiz diskutiert wird. Konkret könnte dies bedeuten, dass wir in Zukunft ähnlich wie bei Elektronikware eine vorgezogene Recyclinggebühr entrichten und so die aufwändige Reparatur oder Rückführung der Produkte und des Materials bewerkstelligen können.
Frage: Für grosse Modemarken und Hersteller ist die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft eine enorme Aufgabe. Was sind die grössten Hürden, die diese Unternehmen überwinden müssen, und welche Rolle spielt dabei die Forschung und Entwicklung, beispielsweise an der HSLU?
Tina Tomovic: Aus meiner Sicht können nicht einzelne Unternehmen eine Patentlösung präsentieren. Aber es braucht Unternehmen, die willig sind, einen langen Atem haben und den Lead übernehmen können für eine motivierte Gruppe von Unternehmen, die das Projekt gemeinsam angehen. Da sind grössere Unternehmen in einer guten Position, gerade weil ein langer Atem wichtig ist.
An der HSLU erforschen wir das Thema der textilen Krauslaufwirtschaft und entwickeln mögliche Lösungen. Textilunternehmen, gross und klein, sind da wichtige Partner:innen und wir hoffen mit unseren Projekten die Industrie bei der Transformation zur Kreislaufwirtschaft unterstützen zu können. Im Forschungsprojekt CUT – Circle Up Textiles werden zurzeit Kollektionen als Fallstudien geplant und im Forschungsprojekt CWW – Circular Workwear testen wir gerade Prototypen für die Arbeitskleidung.
Fazit
Wir danken Tina Tomovic für diese spannenden Einblicke und ihre klare Botschaft: Die Kreislaufwirtschaft ist ein Muss für unsere Modezukunft, und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten. Gemeinsam mit allen Beteiligten können wir das System verändern – durch bewussten Konsum, sorgfältige Pflege und innovative Ansätze in der gesamten Lieferkette.